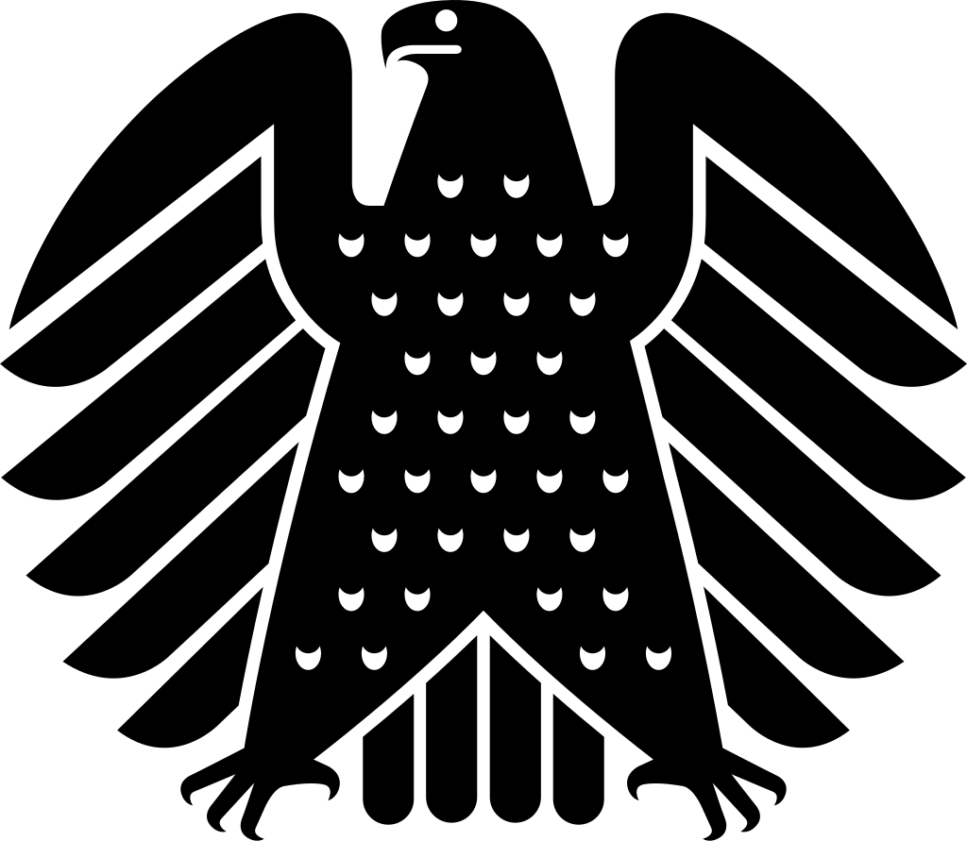Keynote beim kinopolitischen Abend von HDF Kino zu „130 Jahre Kino in Deutschland
Berlin, 12.11.2025
Keynote beim kinopolitischen Abend von HDF Kino zu „130 Jahre Kino in Deutschland von Sven Lehmann
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Vertreter*innen der Kino- und Filmbranche,
liebe Cineastinnen und Cineasten,
liebe Frau Berg, liebe Frau Lindenmaier,
liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundestag,
lieber Louis Klamroth,
Herzlichen Glückwunsch uns allen zu 130 Jahren KINO in Deutschland!
130 Jahre – das ist eine eindrucksvolle Zahl.
Sie steht nicht nur für eine künstlerische Erfolgsgeschichte,
sondern für eine Kultur-, Gesellschafts- und Technikgeschichte sondergleichen.
Eine Geschichte mit Auf und Abs, mit Rückschlägen und Comebacks.
130 Jahre ist es her, dass die Kinogeschichte in Deutschland begann.
Am 1. November 1895 zeigten die Brüder Max und Emil Skladanowsky im Berliner Varieté Wintergarten an der Friedrichstraße die „lebenden Photographien“.
Wenige Wochen später starteten die sehr einflussreichen Brüder Lumière mit ihren Kurzfilmen im Grand Café in Paris.
Diese Momente markierten die Geburtsstunde des Kinos in Europa.
Seitdem ist das Kino zu einem unverzichtbaren Teil unserer Gesellschaften geworden.
Das Kino ist ein Ort, an dem Menschen unterschiedlichster Herkunft, Generation und Erfahrung zusammenkommen,
um für eine begrenzte Zeit etwas gemeinsam zu erleben,
in andere Welt, in andere Leben einzutauchen.
Um zu lachen, zu weinen, mitzufiebern, andere Perspektiven und Menschen zu verstehen, und auch sich selbst neu zu erkennen.
Ein Ort, der mich in seiner Einfachheit immer wieder verblüfft:
ein dunkler Raum, ein Lichtstrahl, bewegte Bilder.
Und plötzlich werden daraus Welten, in die wir eintauchen.
Ich glaube jede und jeder kann sich an seine ersten Male im Kino erinnern.
Meine eigenen ersten Erinnerungen an das Kino liegen in den 1980er Jahren.
In meiner Heimatstadt im Rheinland gab es damals noch kein oder gerade wieder kein Kino,
also fuhren wir mit dem Auto oder Bus ins benachbarte Siegburg,
in ein kleines Kino mit 3 Sälen.
Schon wenn es die Treppe hinauf ging, roch es nach süßem Popcorn. Beim Anstehen an der Warteschlange dann die spannende Frage: Gibt es noch Tickets?
Und wenn wir es geschafft hatten, die begehrten Streifen in der Hand zu halten, begann das Abenteuer.
Ich erinnere mich nicht mehr genau an meinen wirklich ersten Kino-Film, aber er könnte von Disney gewesen sein.
Vielleicht war es aber auch die unendliche Geschichte
von Michael Ende unter der Regie von Wolfgang Petersen.
Diese Geschichte des jungen Kriegers Atréju,
der sich auf eine Reise begibt, um der Herrscherin von Phantásien zu helfen, weil sie schwer erkrankt ist.
Es kann aber auch Ronja Räubertochter gewesen sein, im selben Jahr erschienen,
diese bewegende Geschichte über tiefe Freundschaft.
Es dauerte nicht lange, da folgte dann Dirty Dancing im Jahr 1987,
wobei ich sehr sicher bin, dass ich den früher als von der FSK erlaubt gesehen habe.
Und daraufhin meinen eigenen kleinen Tanzclub in der Grundschule gründete,
um die Szenen aus dem Film nachzuspielen –
natürlich nur die Tanzszenen.
Noch heute frage ich mich manchmal,
was eigentlich genau „dirty“ an dem „dancing“ war,
aber das ist eine andere Sache.
Damals war Kino für mich als Kind und Jugendlicher reine Unterhaltung.
Erst heute, nach vielen Jahrzehnten Cineast sein und hunderte Filme später, weiß ich,
was Filme auch für eine politische und gesellschaftliche Kraft entfalten konnten und bis heute können.
Rosa von Praunheim etwa, der mit seinem Film
„Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“,
der mit diesem Film Anfang der 1970er eine ganze Bürgerrechtsbewegung in Deutschland in Gang gesetzt hat,
mit großen Erfolgen wie der Entkriminalisierung gleichgeschlechtlicher Liebe.
Oder der Film „Schindlers Liste“,
der eine weltweite Debatte auslöste, unter anderem auch zu der brisanten und durch und durch politischen Frage:
Kann es Gutes im Bösen geben?
Film ist große Kunst.
Und zwar, weil Film so viele Kultursparten miteinander vereint:
Literatur und Drehbücher, Schauspiel, Gesang, Tanz, Tontechnik, Filmmusik, Kostüme, Maske, Schnitt, Vermarktung und vieles mehr.
Jeder Film ist ein Gesamt-Kunstwerk –
ob wir dieses Kunstwerk nun mögen oder nicht, aber er ist es.
Und ich bin der festen Überzeugung:
Film ist nur richtig gut und richtig bedeutend durch das Kino.
Denn erst durch das Kino erlangt das Kunstwerk Film seine gesellschaftspolitische Bedeutung für unsere Demokratie.
Klar kann man sich Filme in Mediatheken oder auf Streaming-Plattformen anschauen.
Klar kann das sehr schön und gemütlich sein.
Man kann sich die Menschen aussuchen, mit denen man schaut, Pause drücken, wann man will,
essen und trinken, was man will.
Aber: Erst der Gang ist Kino, um einen Film anzusehen,
macht dieses Erlebnis Film zu einem kollektiven Erlebnis.
Wenn ich den Film „Ghost – Nachricht von Sam“ schaue und in der Schlüsselszene der Geist von Patrick Swayze noch einmal erscheint, um Demi Moore zu berühren
und dabei die Unchained Melodie erklingt,
dann sehe ich im Kino in der Reihe neben und vor mir viele Tränen und höre Taschentücher im ganzen Saal.
Und ich weiß: Das berührt uns gemeinsam.
Wenn ich „Der bewegte Mann“ schaue und mich kaputt lache über die Darstellung von schwulen Männern in den frühen 90ern und dann danach mit Freunden diskutiere,
die das zwar lustig, aber auch total einseitig und klischeehaft finden,
dann weiß ich, dass Sönke Wortmann in ein Wespennest einer Debatte gestochen hat,
die immer zwischen Humor und Ernsthaftigkeit geführt wird.
Wenn ich „3 Tage in Quibéron“ schaue,
in der Marie Bäumer die leidende Romy Schneider so überzeugend spielt, dass man den Atem anhält,
dann wünsche ich mir zwar kurz allein zu sein mit dieser Stimmung,
aber, – und genau das ist der Punkt:
Wir sind eben nicht allein in dieser Gesellschaft.
Und das ist auch gut so.
Wir sind eine Gesellschaft.
Und bestenfalls lachen, fühlen, leiden, träumen wir gemeinsam im Kino,
und dann ist es das höchste Glück bei einem Film,
denn es hebt das eigene Erleben auf eine noch höhere Stufe.
Der große David Lynch hat einmal gesagt:
„Die Intelligenz in einem Kinosaal ist größer als die Summe der Anwesenden.“
Ich liebe dieses Zitat, weil es so viel über das Kino aussagt – und auch über uns.
Denn im Kinosaal entsteht etwas, das größer ist als wir selbst.
Wir reagieren gemeinsam, wir interpretieren gemeinsam, wir fühlen gemeinsam – und aus all dem entsteht eine Art kollektive Wahrnehmung, eine geteilte Intelligenz.
Wenn der Abspann läuft und man den Blick durch den Saal schweifen lässt, sieht man oft etwas Erstaunliches:
niemand ist derselbe Mensch wie zwei Stunden zuvor.
Wir haben gelacht, geweint, gezweifelt, gehofft –
und wir tun es nicht allein.
Und klar, manchmal sind wir genervt, auch das kommt vor:
vom lauten Getuschel im Saal,
von den knackenden Nachos,
von den schlürfenden Cola-Bechern,
vom Lachen an der falschen Stelle.
Das nervt. Aber auch das ist Gesellschaft. Auch das ist Demokratie.
Die Unterschiedlichkeit von Menschen kann manchmal nerven.
Vielfalt kann nerven.
Aber sie ist Realität.
Und genauso verhält es sich mit unserer Demokratie.
Wir müssen miteinander klarkommen.
Aber das ist keine Last, sondern das ist ein Gewinn.
Und genau deshalb ist das Kino wichtiger denn ja.
Denn in unserer heutigen Gesellschaft drohen uns die gemeinsamen Räume und Erfahrungen abhanden zu kommen.
Das Kino ist ein Gegenmittel zum Rückzug in die eigene Blase,
zur Vereinzelung.
Das Kino ist eine Schule des Sehens, des Fühlens, des Miteinander-Denkens.
Das Kino ist, wenn man so will, ein demokratischer Erfahrungsraum.
Und auch das gehört zur Wahrheit:
Auch wenn immer wieder geklagt wird über hohe Ticket-Preise:
Das Kino bietet einen der niedrigschwelligsten Zugänge zur Kultur überhaupt.
Das gilt ganz besonders für ländliche Regionen, in denen in den vergangenen Jahren viele kulturelle Angebote ausgestorben sind und Kinos oft die letzten kulturellen Orte sind.
Ich würde nun gerne genau hier enden,
aber so sehr dieser Abend ein Anlass zum Feiern und ein Moment zur Würdigung des Kinos ist,
so ehrlich müssen wir auch sein:
Das Kino und mit ihm der deutsche Film stehen unter enormem Druck.
Die Corona-Pandemie hat vieles verändert:
Sehgewohnheiten, Finanzierungsmodelle, Publikumsverhalten.
Streamingdienste haben die Konkurrenz verschärft,
das Publikum hat sich in den digitalen Raum verlagert,
viele Kinos kämpfen seitdem ums Überleben und stehen vor der Herausforderung, notwendige Modernisierung zu finanzieren.
Auch im letzten Jahr haben wieder mehr Kinos geschlossen als neue eröffnet wurden, auch Ticketverkäufe und Umsätze waren rückläufig.
Deshalb müssen wir gerade auch heute Abend darüber sprechen,
was wir politisch tun müssen.
Dazu möchte ich eine aus meiner Sicht ganz zentrale These vorwegschicken,
bevor dann gleich das Panel diese Fragen sicher vertiefen wird.
Wir müssen die Wertschöpfungskette des Films als Ganzes denken – vom Drehbuch über die Produktion bis zur Ausspielung im Kino.
Denn was nützt die beste Förderung,
wenn am Ende das Publikum fehlt, weil die Kinos verschwinden?
Und was nützt das schönste Kino,
wenn deutschsprachige Produktionen nicht mehr zustande kommen, weil andere Länder bessere Bedingungen haben?
Die neue Regierungskoalition hat sich für die Filmbranche ein Steueranreizmodell und eine Investitionsverpflichtung in den Koalitionsvertrag geschrieben. Das ist sehr gut und sehr wichtig.
Ich nehme aber zur Kenntnis, dass sich der Kulturstaatsminister von diesen Zielen verabschiedet hat, zumindest von einer gesetzlichen Investitionsverpflichtung.
Ich halte das für falsch, denn beides zusammengenommen würde endlich die notwendige und verlässliche Planungssicherheit für die Branche bieten.
Die Koalition hat sich auch vorgenommen,
die Kinos in ihren Investitionen verlässlich unterstützen.
Und auch hier nehme ich zur Kenntnis, dass das enorm erfolgreiche „Zukunftsprogramm Kino“ allenfalls mit Restmitteln fortgeführt werden soll.
Und dazu möchte ich sagen:
Wenn in einem Rekordhaushalt des BKM mit einem Aufwuchs von fast 10 Prozent kein Aufwuchs für das „Zukunftsprogramm Kino“ zu finden ist, das scheitert dies nicht an fehlenden haushälterischen Spielräumen,
sondern schlichtweg an einer mangelnden Priorität für das Kino.
Auch das halte ich für ein Problem.
Denn im Gesamthaushalt sind das keine riesigen Summen,
aber für jedes einzelne Kino,
das eine Förderung und Unterstützung erhält, ist es Gold wert.
Denn dort, wo das letzte Kino schließt, verliert eine Stadt oder Gemeinde nicht nur einen Kulturort –
sie verliert ein Stück Öffentlichkeit, ein Stück Seele.
Wenn wir wollen, dass Kinos Teil unserer kulturellen Infrastruktur bleiben, dann müssen wir sie auch so behandeln.
Nicht als nostalgisches Hobby, sondern als öffentliche Aufgabe.
So wie das beispielsweise Frankreich tut, mit großen Erfolgen für die Kinolandschaft.
Ich finde, wir sollten mutiger sein, wenn es um unsere deutschsprachigen Kulturgüter geht.
Und da sollten wir etwas mehr Frankreich wagen, wenn darum geht, Streamer in Deutschland zu Investitionen gesetzlich zu verpflichten,
und unsere Kinos durch eine Sperrfrist zu schützen.
Das ist kein Nationalismus, sondern kluge Standortpolitik.
Ja, nicht alle französischen Regelungen sind im deutschen Föderalismus übertragbar,
aber die Haltung können wir uns doch zu eigen machen,
wenn es darum geht, unsere Kunst und Kultur zu unterstützen und zu schützen.
Das sollte unsere gesellschaftliche und vor allem politische Aufgabe sein.
Und damit möchte ich auch zum Schluss kommen.
130 Jahre Kino in Deutschland haben gezeigt:
Das Kino hat Kriege überstanden, Diktaturen, technologische Revolutionen – und immer wieder bewiesen:
Es ist anpassungsfähig, ja,
aber es bleibt unverwechselbar.
Vielleicht ist das sein größtes Geheimnis:
Dass es sich ständig wandelt – und dabei in seinem Kern treu bleibt.
Das Kino ist ein Raum, in dem wir lernen, die Welt mit anderen Augen zu sehen –
und das ist, im besten Sinne, politisch.
Deshalb:
Feiern wir heute das Kino – und verpflichten wir uns, dafür zu sorgen, dass es bleibt.
Dass es auch in zehn, zwanzig, fünfzig Jahren noch Orte gibt,
an denen Menschen zusammenkommen,
um im Dunkeln zu träumen, zu lachen, zu staunen.
Orte, an denen – um David Lynch noch einmal zu zitieren –
die Intelligenz im Raum größer ist als die Summe der Anwesenden.
In diesem Sinne:
Herzlichen Glückwunsch zu 130 Jahren Kino in Deutschland.
Und vielen herzlichen Dank
für Ihre Leidenschaft, Ihre Arbeit und Ihren Glauben
an die Kraft der Bilder.