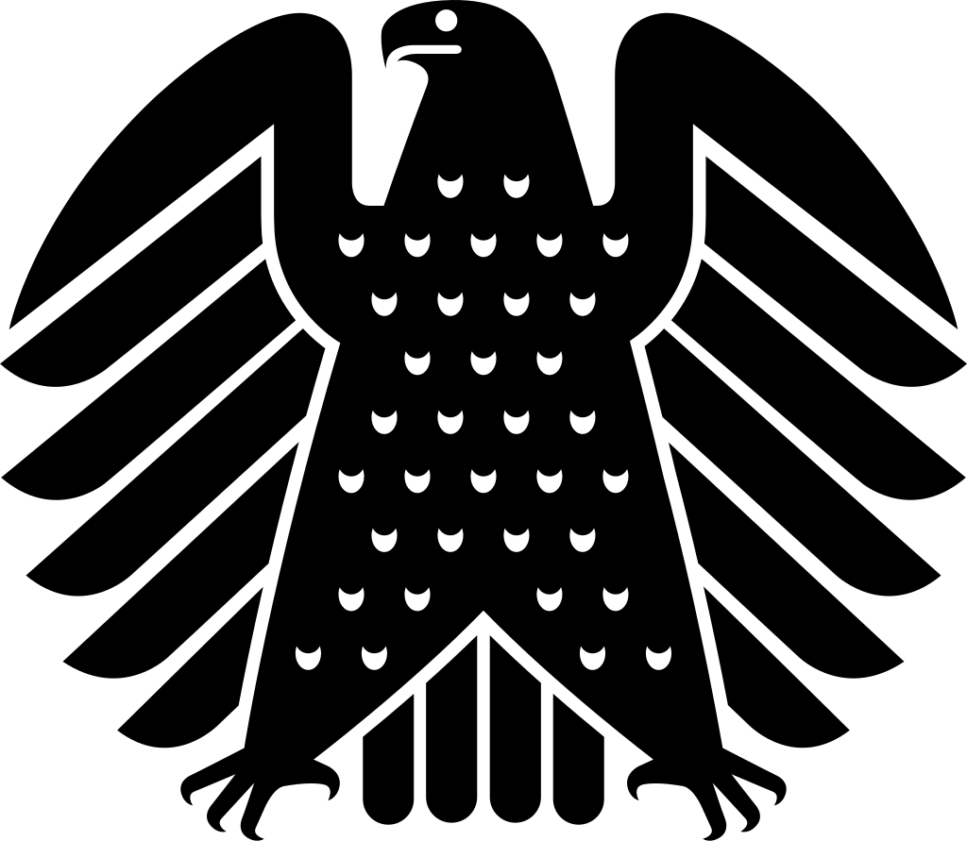Kultur braucht Vielfalt – und eine klare Haltung. Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung
Die Freiheit ist kein neutraler Raum. Sie lebt davon, dass alle Menschen in ihr atmen können. Freiheit braucht Vielfalt. Und sie braucht Haltung – keine falschen Gleichsetzungen.
Gastbeitrag von Sven Lehmann
In seinem Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung zieht Kultur-Staatsminister Dr. Wolfram Weimer höchst fragwürdige Parallelen zwischen rechter und linker Kulturkritik. Beide Seiten, so seine Betrachtungsweise, würden gleichermaßen „bevormundende Identitätskämpfe“ führen und damit die Freiheit von Kunst und Kultur gefährden. Besonders scharf geht er mit vermeintlich „linkem Alarmismus“ ins Gericht, warnt vor „Tugendterror“ und „Cancel Culture“. Die Kritik auf sozialen Plattformen an transfeindlichen Äußerungen von J.K. Rowling wird en passant mit dem Angriff von US-Präsident Donald Trump auf Harvard gleichgestellt. Willkommen in der Welt der Hufeisen!
Seit seinem Amtsantritt ist der neue Staatsminister sichtlich bemüht, das Image des rechten Kulturkämpfers abzustreifen, welches ihm seit seinem „konservativen Manifest“ anhaftet. Das gelingt mit dem Gastbeitrag nur unzureichend. Ironischerweise verfällt seine Positionierung leider genau jener aggressiven Polemik rechter Kulturkämpfer, die er zu Recht kritisiert – nur eben getarnt im Schafspelz. Oder treffender: im Maßanzug liberaler Hochkultur.
Wohlwollend könnte man sagen, dass seine Betrachtungsweise unterkomplex ist, treffender mit Blick auf sein wichtiges politisches Amt wäre aber: politisch gefährlich. Die Gleichsetzung linker und rechter Diskurse im Muster der Hufeisentheorie, in der die Ränder sich näherstehen als der Mitte, verkennt die politische Realität rechtsextremer Bedrohungen. Wer feministische oder anti-rassistische Bewegungen, die sich für Gleichberechtigung und Teilhabe einsetzen, pauschal als ideologisch motivierte Bedrohung für die Kunstfreiheit darstellt, leistet letztlich jener Polarisierung Vorschub, vor der Weimer selbst warnt. Und die zu verhindern unsere Aufgabe als Politiker*innen in den kommenden Jahren sein wird, wenn wir ein weiteres Erstarken des Rechtsextremismus verhindern wollen.
Natürlich gibt es auch am linken Rand übergriffige Versuche, Kunst politisch zu vereinnahmen. Die Verbannung einer Venus-Bronze aus einer Berliner Behörde etwa gehört dazu. Doch die Beispiele, die Weimer dafür bemüht, greifen insgesamt zu kurz.
Dieter Nuhr etwa hat – trotz aller Kritik, die ihm entgegenschlägt – weiterhin einen prominenten Sendeplatz in der ARD, von dem andere Kulturschaffende nur träumen können.
Und J.K. Rowling? Sie gehört zur globalen kulturellen Machtelite. Ihr Vermögen wird auf eine Milliarde Euro geschätzt. Sie ist kein Opfer eines Kulturkampfs, sie ist eine der treibenden Kräfte. Erst kürzlich hat sie sich selbst dafür gefeiert, die Grund- und Menschenrechte von transgeschlechtlichen Menschen in Großbritannien nach einer jahrelangen Hetzkampagne eingeschränkt zu haben.
In Deutschland ordnet kein Staat die Kultur einem politischen Machtanspruch unter, im Gegenteil: Bürger*innen und auch Kultur- und Medienschaffende artikulieren Kritik und machen auf Diskriminierung und gesellschaftliche Schieflagen aufmerksam. Diese Auseinandersetzungen finden in einer Gesellschaft statt, die – zu Recht – Meinungs- und Kunstfreiheit als hohes Gut schützt. Und dazu gehört eben auch das Recht, Position zu beziehen – möge sie gefallen oder auch nicht.
Ist es etwa nicht legitim, dass die Zivilgesellschaft sich mit unserem historischen Erbe auseinandersetzt und hinterfragt, wo noch heute Kolonialherren durch Plätze oder Statuen geehrt werden? Wer solche Initiativen als Bedrohung für die Freiheit der Kunst versteht, verkennt, dass hier nicht die Kunst zensiert wird, sondern dass sich Stimmen zu Wort melden und damit den Diskursraum weiten – also genau das, was Weimer einfordert. Das mag unbequem sein, oft laut, manchmal schrill, aber das ist gelebte Demokratie. Wir leben in einer pluralen Gesellschaft und müssen Meinungen aushalten, die wir vielleicht selbst nicht teilen.
Die Freiheit der Kultur bedeutet nicht nur die Abwesenheit von Zensur, sondern auch die aktive Ermöglichung und Sichtbarmachung vielfältiger Stimmen, Perspektiven und Ausdrucksformen. Sie setzt voraus, dass alle gesellschaftlichen Gruppen – insbesondere marginalisierte – gleichberechtigten Zugang zu kultureller Produktion, Repräsentation und Öffentlichkeit haben. Kulturelle Freiheit ist also untrennbar mit sozialer Gerechtigkeit und struktureller Teilhabe verbunden. Diese Art der Kulturkritik ringt darum, dass Kunst Räume öffnet – für diejenigen, die lange ausgeschlossen waren. Sie kämpft für Zugang, Sichtbarkeit, Anerkennung. Nicht gegen die Freiheit, sondern für ihre Erweiterung. Der Kulturkampf von Rechts – wie Trumps Bücher-Verbotslisten oder Russlands Repressionen der Meinungsfreiheit – zielt hingegen auf Autorität, Einengung und neue Ausschlüsse.
Hier reden wir nicht nur von den physischen Bedrohungslagen, denen Kulturschaffende ausgesetzt sind. Hier reden wir von den politischen Gremien, in denen rechtsextreme Kräfte Einfluss auf Haushalts-, Förder- und Personalentscheidungen im Kulturbereich erhalten. Noch vor wenigen Tagen hat die freie Kunst- und Kulturszene in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vor drastischen Kürzungen und der politischen Einflussnahme im Lichte der erstarkten AfD gewarnt.
Kultur kann so stark, widerstandsfähig und frei sein, wie sie will – wenn ihr das Geld entzogen wird, wird ihre Stimme leiser.
Wie aber sichern wir die Freiheit der Kultur konkret? Langfristig helfen Kunst und Kultur keine Appelle zur Liberalität, sondern verlässliche Strukturen: öffentliche Förderung unabhängig von politischer Opportunität, Schutzräume für marginalisierte Stimmen und eine Kulturpolitik, die Teilhabe garantiert – und nicht nur Besitzstand verteidigt.
Wir müssen die Kulturförderung so gestalten, dass sie nicht vom good will einer jeweiligen Regierungspartei abhängt. Kunst braucht ein stabiles Fundament, auf dem sie gedeihen kann. Hier müssen uns nicht nur die Bemühungen der Demokratiefeinde um Mitsprache in Zuwendungs- und Personalentscheidungen eine Mahnung sein, sondern auch die große Verunsicherung und Sorge in der Kulturbranche infolge von Kürzungen auf Länderebene und nach dem geplatzten Haushalt im letzten Jahr auf Bundesebene.
Bundesregierung und Parlament müssen hier schnell Sicherheit geben. Der Staatsminister muss es sich zur Aufgabe machen, dass Mittel aus dem 500 Milliarden Euro schweren Sondervermögen auch für die Sanierung der deutschen Kulturbauten aufgewendet werden. Auch die Einnahmen aus der geplanten „Plattform-Abgabe“ müssen eins zu eins für die Kulturförderung zur Verfügung stehen. Wenn er das durchsetzt, hat er mit Sicherheit die Unterstützung der demokratischen Opposition im Bundestag.
Wir müssen sicherstellen, dass Menschen sich mithilfe von unabhängigem Journalismus eine fundierte Meinung bilden können. Das gilt insbesondere für den Lokaljournalismus, der in weiten Teilen in seiner Existenz bedroht ist. Auch unsere Verlagslandschaft muss vielfältig bleiben und Geschichten eine Öffentlichkeit geben, die sonst unerzählt blieben.
Wir können als Politik und Staat dem Bürgertum in seiner Breite sehr dankbar sein, dass es „dafür sorgt, dass unsere Theater voll, unsere Museen bestens frequentiert und unsere Konzerthallen gut gefüllt sind“ – wie Wolfram Weimer es richtig schreibt. Kultur darf aber nicht auf Theater-Abos und Museumsbesuche reduziert werden. Das blendet die Vielfalt aus, die sie wirklich ausmacht. Sie lebt ebenso von den Clubs und den Festivals, von den Volksbühnen und zahllosen ehrenamtlich organisierten Musik- und Gesangsvereinen, die durch ihre Leidenschaft für Musik und Schauspiel ein verbindendes Gemeinschaftsgefühl entstehen lassen und mit ihren Vereinsstrukturen Demokratie im Kleinen leben.
Kunst ist ein Trainingsfeld für Ambiguität. Gerade die Widersprüchlichkeit macht sie politisch. Und darin liegt ihre Kraft. Die Gesellschaft politisiert sich, Bürger*innen fordern Differenzierung, Mitsprache und Haltung ein. Wenn Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit aufeinandertreffen, braucht es keine Angst, keine Abwehrhaltung, kein Verdrängen der Meinungen an die politischen Ränder, keine falschen Parallelen zwischen Rechts und Links – sondern hier braucht es ein Aushalten.
Was Wolfram Weimer als „linken Kulturkampf“ beschreibt, ist oft nichts anderes als ein Diskurs im demokratischen Raum um Anerkennung und Teilhabe. Der Kulturkampf von Rechts hingegen zielt auf Kontrolle, Einschränkung, Ausgrenzung. Genau hier müssen wir widersprechen – als Gesellschaft und als Parlamentarier*innen. Die Aufgabe des Bundestags ist es, die Kunst- und Meinungsfreiheit zu schützen, dafür das notwendige Fundament auszubauen und ihre Vielfalt zu sichern.
Die Freiheit ist kein neutraler Raum. Sie lebt davon, dass alle Menschen in ihr atmen können. Freiheit braucht Vielfalt. Und sie braucht Haltung.