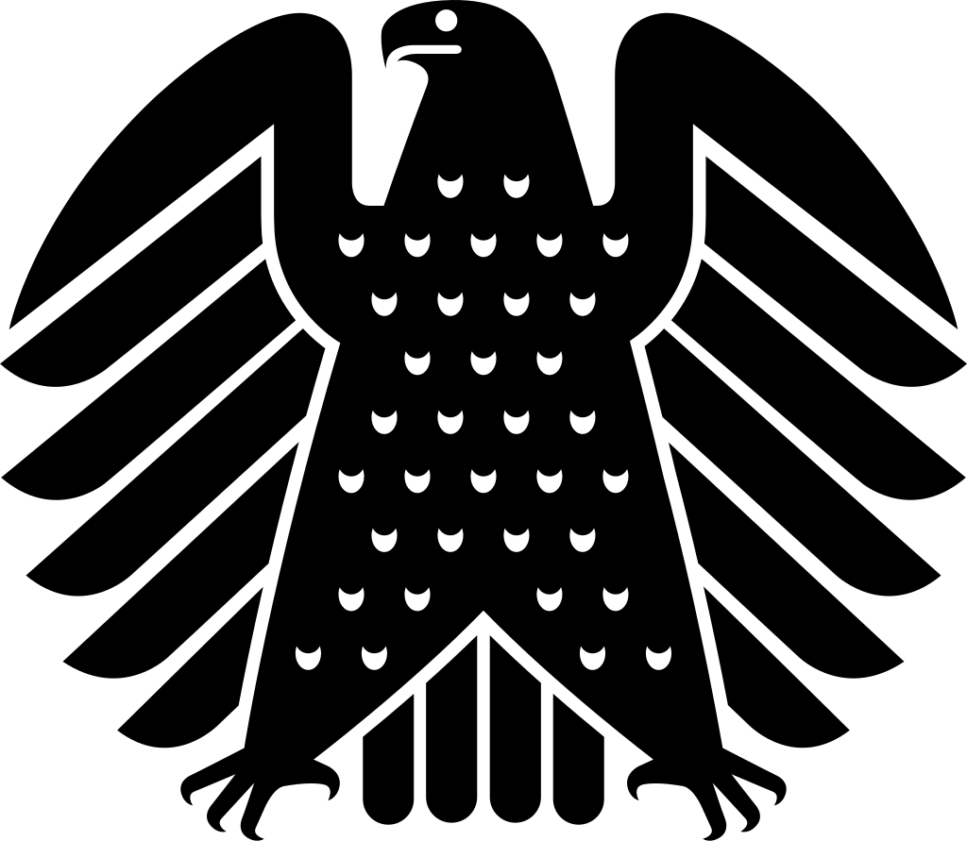„Kultur hat eine ähnliche Kraft wie Sport“. Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger
Herr Lehmann, vor kurzem wurden Sie im Bundestag zum Vorsitzenden des Kultur- und Medienausschusses gewählt. In Zeiten, in den gespart werden muss, muss die Kultur oft als erste dran glauben, wenn es um Förderung geht. Wie gehen Sie damit um?
Das ist ein Problem. Kultur ist kein “nice to have”, sondern für unsere Gesellschaft unverzichtbar. Wir haben während der Corona-Beschränkungen gemerkt, dass es zwar für kurze Zeit aushaltbar war, nicht ins Kino oder auf ein Konzert zu gehen, aber nicht auf Dauer. Aber ja, Kultur steht unter starken Sparzwängen, weil sie eine sogenannte „freiwillige Aufgabe“ ist. Davon müssen wir weg. Durch ein Staatsziel Kultur im Grundgesetz könnte man ihr in ihrer Vielfalt die Bedeutung geben, die sie hat. Kultur – und auch die Kulturpolitik – könnte sich zum Beispiel am Sport orientieren.
In welcher Hinsicht?
Der Sport hat es geschafft, über den Breitensport eine starke integrative Kraft zu entwickeln. Viele Menschen machen Sport in Vereinen, da kommen Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammen. Dort wird Demokratie gelebt – auf und neben dem Platz.
Kultur dagegen wird oft als elitär wahrgenommen. Auch in der Politik ist zuweilen ein sehr elitäres Verständnis von Kultur zu finden. Dabei ist natürlich auch der ehrenamtliche Chor im Bürgerzentrum Kultur, ebenso wie das Festival oder die kleine Buchhandlung in der Nachbarschaft. Ich glaube, Kultur hat eine ähnliche Kraft wie der Sport. Wir müssen aber bessere Zugänge schaffen und auch von politischer Seite ein breiteres Kulturbild vermitteln.
Wie schauen Sie denn auf die Kölner Kulturpolitik der letzten Jahre? Wo sehen Sie hier die größten Baustellen?
Köln ist Kulturstadt. Ich war gerade in den letzten Tagen viel unterwegs, auch bei wunderbaren Formaten wie dem Africologne-Festival oder der ersten „Langen Nacht der Lyrik“. Die Kulturpolitik in Köln und NRW, die ja sehr stark für die Finanzierung verantwortlich sind, ist mit den Sparzwängen in den Haushalten auch an die freie Szene rangegangen, das hat zu Recht Proteste provoziert. Daraufhin wurden Kürzungen teilweise oder ganz wieder zurückgenommen. Das ist aber kein Dauerzustand. Länder und Kommunen, aber eben auch der Bund, müssen für eine strukturell verlässliche Finanzierungsbasis sorgen. Kultur braucht Planungssicherheit. Wenn eine Bibliothek oder ein Theater einmal geschlossen wird, kommt es meistens nicht zurück.
Eine Besonderheit des deutschen Systems sind die vielen staatlich finanzierten Kultureinrichtungen. In anderen Ländern gibt es mehr private Finanzierung und Sponsoring. Ist es noch zeitgemäß, eine Opernkarte für eine kleine Minderheit mit viel Geld zu bezuschussen?
Kultur ist immer chronisch unterfinanziert gewesen. Aktiv auf Menschen mit einem hohen Vermögen zuzugehen, um auch privates Geld für eine Ausstellung oder ein Museum zu gewinnen, finde ich sehr gut. Trotzdem möchte ich dieses Konkurrenzverhältnis zwischen dem Opernhaus und der freien Szene befrieden. Beides ist wichtig. Es ist aber leider besonders oft die freie Szene, mit ihren vielen selbstständig Tätigen und weniger arbeitsrechtlichen Absicherungen, die als erste und oft sehr massiv unter Spardruck gerät. Das haben wir in Berlin gesehen, aber eben auch in Köln und NRW. In der letzten Wahlperiode hat Claudia Roth damit begonnen, die Gelder für die Bundeskulturfonds zu erhöhen. Der Spardruck besteht aber leider weiterhin.
Wie kann man den abfedern?
Ich habe mit Interesse wahrgenommen, dass der neue Kulturstaatsminister Wolfram Weimer eine Digitalabgabe auf große Plattformen wie Google vorschlägt. Das finde ich sehr gut und unterstützenswert, aber die Einnahmen müssen dann auch eins zu eins der Kulturförderung und den Kulturschaffenden zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel über die bestehenden Bundeskulturfonds. Die Einnahmen dürfen nicht im allgemeinen Haushalt versickern. Mit einem Plattform-Soli könnte man den Kultur-Etat strukturell deutlich verbessern, zumindest auf Bundesebene. Und eine zweite Sache ist wichtig.
Welche?
Wir sprechen gerade sehr oft über das Sondervermögen, diese 500 Milliarden Euro, die zur Verfügung stehen. Es geht dabei zu Recht um unsere Verkehrsinfrastruktur und so weiter. Aber kaum jemand redet dabei über Kultur. Ich setze mich dafür ein, einen Teil des Geldes für die Sanierung der Kulturbauten zur Verfügung zu stellen. Die neue Bundesregierung und der neuen Staatsminister sind in der Pflicht, dafür zu kämpfen, dann könnte da auch der Bund die Länder und Kommunen spürbar unterstützen.
Wolfram Weimer ist ja nicht unumstritten. Wie stehen Sie zu dieser Personalie?
Ich habe natürlich wahrgenommen, dass die Kulturszene in hellem Aufruhr war. Denn Wolfram Weimer ist in der Vergangenheit als Verleger und Autor mit Schriften aufgefallen, in denen er sich in Richtung Blut-und-Boden-Deutschtümelei äußert. Dabei ist Kultur immer kosmopolitisch und vielfältig. Leider hat er mit einem prominenten Gastbeitrag in der vergangenen Woche erneut die Keule des Kulturkampfes geschwungen und letztlich linke mit rechter Kulturkritik gleichgestellt. Ich halte das für falsch und habe deshalb auch öffentlich auf seinen Gastbeitrag geantwortet. Wir müssen Kultur in ihrer Freiheit und Vielfalt aktiv schützen. Darauf werde ich als Ausschussvorsitzender sehr genau achten. Wolfram Weimer steht in der Verantwortung, sich an die Seite der Kunstfreiheit zu stellen und rechten Kulturkämpfern klare Kante zu zeigen.
Hätten Sie sich einen anderen Kulturstaatsminister gewünscht?
Ich bin dafür, jeden an seinen Taten zu messen. Es gibt auch erste gute Impulse, wie zum Beispiel sein Vorhaben zu einer Digitalabgabe. Ich bin sehr gespannt, was da kommt und ob er sich damit durchsetzen kann. Im Koalitionsvertrag der neuen Regierung steht ja alles unter Finanzierungsvorbehalt, es soll zum Beispiel erst geprüft werden, ob der Kulturpass für junge Menschen fortgeführt wird. Ich bin sehr dafür, dies zu tun. Es ist wichtig, Kultur in der Breite erlebbar zu machen und schon früh Zugänge zu Büchern, Kino oder Theatern zu schaffen. Der Kulturpass muss unbedingt erhalten bleiben.
Wie gehen Sie damit um, dass vier Mitglieder des Kulturausschusses der AfD angehören und sicher andere Ziele als Sie verfolgen?
Als Ausschussvorsitzender achte ich selbstverständlich darauf, dass die Regeln fair sind und dass alle Ausschussmitglieder gleiche Rechte als Abgeordnete haben – egal, welcher Fraktion sie angehören. Aber inhaltlich werde ich dafür streiten, dass die Forderungen der AfD in der Kulturpolitik nicht mehrheitsfähig werden. Ein Beispiel: Wir haben ja eine lange Debatte geführt über die Rückgabe der Benin-Bronzen. Restitution und Provenienzforschung sind für die AfD Teufelszeug. Für mich ist es Gerechtigkeit. Zweites Beispiel: Beim Thema Erinnerungskultur geht es nicht nur um die Nazi-Verbrechen oder Verbrechen der DDR-Diktatur, sondern auch um deutschen Kolonialismus und die Verbrechen des NSU, die in Gedenkkonzepte gehören. Es ist unsere Aufgabe, die Erinnerung auch an die Tiefpunkte deutscher Geschichte wachzuhalten, damit sie sich nicht wiederholen. Dafür werde ich mich stark machen.
Empfinden Sie die AfD als bedrohlich?
Als der neue Bundestag zusammenkam und ich zum ersten Mal in den neuen Plenarsaal ging und da doppelt so viele Rechtsextreme saßen wie vorher, hat sich das schon bedrohlich angefühlt. Daher ist es gerade jetzt entscheidend, als Demokraten über die Parteigrenzen hinweg zusammenzuarbeiten, was ja zum Beispiel beim Beschluss über das Sondervermögen gelungen ist. Aber der Zulauf zur AfD macht mir wirklich große Sorgen.
Wie kann man diesen stoppen?
Ich glaube, dass das auch ein Ergebnis von unregulierten Plattformen wie Tiktok ist, von zu wenig kritischer Medien- und Kulturbildung. Und auch von einem Verschwinden von Lokalredaktionen, gerade in ländlichen Räumen, wo es dann kaum mehr Meinungsvielfalt gibt. Diese Probleme haben alle politisch Verantwortlichen zu lange laufen lassen. Das Ergebnis sehen wir jetzt: Viele Jugendliche informieren sich nur noch bei Tiktok. Sie sind der Plattform mit ihren undurchsichtigen Algorithmen im Prinzip ausgeliefert und finden nur zu selten Räume in der Schule oder Freizeit, diese Meinungen kritisch zu hinterfragen. Die Regulierung der Plattformen auf europäischer Ebene steht jetzt dringender an denn je.
Sie betonen die Bedeutung der Presse, gerade auch der Lokalpresse für die Demokratie. Doch die Vielfalt ist in Deutschland stark gefährdet.
Ich bin sehr entschieden dafür, den Lokaljournalismus zu stärken, nicht nur im Digitalen. Leider ist da in den letzten Jahren viel zu wenig bis gar nichts passiert. Eine gezielte Förderung von Verlagshäusern und gerade von Lokaljournalismus ist wichtig. Damit meine ich nicht eine Mehrwertsteuersenkung mit der Gießkanne, sondern wirklich aktive Förderung, zum Beispiel durch die finanzielle Unterstützung von lokalen Redaktionen, um Journalistinnen und Journalisten einstellen zu können. Und auch das Abwandern von Werbebudgets ins Digitale ist ein Problem. Nachrichten, die durch Lokaljournalismus erzeugt werden, durchlaufen eine Qualitätssicherung. Das ist für die Glaubwürdigkeit unabhängiger Medien und auch für eine starke Demokratie hochrelevant. Bei Kultur und Medien gibt es Bereiche, die sich nicht selbst tragen, die subventioniert werden müssen, weil sie essentiell für unsere Demokratie sind. Dabei ist es besonders wichtig, dass diese Förderung staatsfern gestaltet wird. In dieser Wahlperiode muss da unbedingt etwas passieren.